Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Interview von Botschafter Graf Lambsdorff mit RTVI
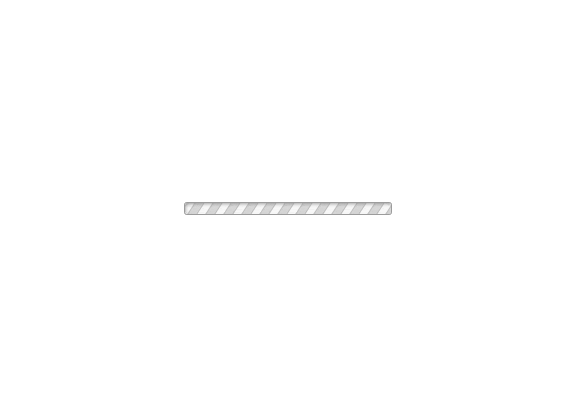
Interview von Botschafter Graf Lambsdorff mit RTVI © Максим Кадропольцев, RTVI
Im Interview mit Jekaterina Sabrodina beleuchtet Botschafter Graf Lambsdorff Deutschlands Haltung zum Krieg in der Ukraine, die Lage zwischen Israel und Iran, die aktuelle Stimmung in der deutschen Gesellschaft – sowie viele weitere aktuelle internationale Fragen.
Arbeitsübersetzung aus dem Russischen
25-0430
Herr Lambsdorff, guten Tag! Vielen Dank für die Möglichkeit, anderthalb Jahre nach unserem letzten Interview erneut mit Ihnen zu sprechen.
- Vielen Dank, dass Sie mich wieder eingeladen haben.
Lassen Sie uns mit einer Nachricht aus der Welt der Diplomatie beginnen. Vor Kurzem hat Russland als erstes Land die Taliban-Regierung und das Islamische Emirat Afghanistan anerkannt. Und just kürzlich sagte der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Berlin brauche direkte Kontakte zu den Taliban, um einige praktische Fragen zu behandeln, und dafür könnten Drittländer als notwendig sein. Könnte Russland als ein solcher Vermittler für Deutschland agieren und mit Kontakten zu den Taliban behilflich sein?
- In absehbarer Zeit werden wir die Taliban politisch nicht anerkennen und die deutsche Regierung sagt es klar und deutlich. Wenn Sie sich ihr Regierungssystem anschauen, das sie im Inneren haben, insbesondere was die Lage der Mädchen und Frauen angeht, dann unterschiedet sich unsere Position deutlich von der russischen in dieser Hinsicht. Russland ist, wie Sie gesagt haben, bisher das einzige Land, das es getan und damit den Rahmen des internationalen Konsenses verlassen hat. Wenn wir technische Gespräche führen, dann tun wir es über aufgebaute Kanäle, die bereits seit einiger Zeit existieren. Ich glaube nicht, dass wir dafür Hilfe von Russland brauchen werden.
Aber Sie arbeiten zurzeit in Moskau und nach Moskau kam jetzt ein Botschafter der Taliban. Werden Sie die Chance ergreifen, Kontakt zu ihm aufzunehmen?
- Das glaube ich nicht – es sei denn, meine Regierung erteilt mir eine entsprechende Weisung. Aber ich wäre erstaunt, wenn es passieren würde.
Kürzlich waren wir Zeuge einer sehr ernsthaften Eskalation im Nahen Osten. Deutschland und die EU stellten sich auf die Seite Israels bei seinem Angriff gegen den Iran. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte: „Israel macht Drecksarbeit für uns alle“. Mir scheint, dass „Drecksarbeit“ ein sehr vielsagender Ausdruck ist. Demzufolge hat Deutschland zwei unterschiedliche Auffassungen für verschiedene Kriegshandlungen. Den militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine betrachtet es vom Standpunkt des Völkerrechts und wirft Russland vor, es zu brechen. Russland erkennt es nicht an, aber die Frage ist eine andere. Den Fall Iran betrachtet Deutschland vom Standpunkt, sagen wir, der Zweckmäßigkeit: Der Iran darf keine Atombombe haben, Punkt. „Ceterum censeo“. Faktisch haben wir es mit Doppelstandards zu tun – ich mag den Begriff nicht, er wird oft zu Propagandazwecken benutzt, aber in diesem Fall sehe ich diese Doppelstandards. Hier das Völkerrecht, dort die Realpolitik, Politik vom praktischen Standpunkt aus. Warum ist es so?
- Nun, in der Tat ist das eine interessante Frage. Und eine sehr schwierige noch dazu, denn bei uns in Deutschland laufen gerade sehr lebhafte Diskussionen unter Völkerrechtsexperten. Manche sagen, wie Sie gerade eben angemerkt haben: Es geht um Zweckmäßigkeit. Vom Standpunkt des Völkerrechts gibt es da keine Rechtfertigung. Andere wiederum sagen, Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung, da Iran mehrfach erklärt habe, dass es der Existenz von Israel als Staat ein Ende setzen wolle. Natürlich spricht man in Teheran nicht direkt von Israel, sondern von einem „zionistischen Regime“ o. Ä. Aber zugleich sehen wir, dass Iran Urananreicherung in einem Maße betreibt, das offenkundig nicht mit seinen Verpflichtungen gegenüber der IAEA und seinen Verpflichtungen gemäß unserem – von Russland, Deutschland, Großbritannien und Frankreich – Joint Comprehensive Plan of Action vereinbar ist. Diese Aktivitäten Irans sind nicht mit dem Atomdeal vereinbar. Und das Wichtigste ist: Der Grad der Anreicherung, an dem die Iraner, wie Sie wissen, gearbeitet und den sie erreicht haben, nämlich 60%, liegt weit über dem, was für eine zivile Nutzung z.B. für die Atomkraftwerke notwendig ist. Deshalb glaube ich, dass die Diskussionen, die wir gerade in Deutschland führen, im Wesentlichen dem entsprechen, was Sie gerade beschrieben haben. War es zweckmäßig? Gibt es dafür eine völkerrechtliche Grundlage? Ich denke, als der Bundeskanzler sagte, Israel mache Drecksarbeit für uns, hat er in aller Klarheit das ausgesprochen, womit, wie ich denke, ein Großteil der internationalen Gemeinschaft inklusive Russland einverstanden wäre. Denn Russland vertritt schon länger die Position, dass Iran keine Atombombe haben darf. Und deshalb, wenn Israel solche Maßnahmen ergreift und das iranische Atomprogramm so zurückwirft, dass dies zum Gegenstand von Rechtsdiskussionen wird, gebe ich Ihnen Recht, und ich glaube, dass der Bundeskanzler genau das gemeint hat.
Die IAEA hat in ihrem Bericht in der Tat festgestellt, dass Iran gegen die Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag verstoßen hat. Und das kann die erneute Einführung von Sanktion gegen den Iran durch den VN-Sicherheitsrat begründen. Aber wie legitimiert es einen militärischen Angriff? Kein einziger Staat wurde wegen – tatsächlicher oder vermuteter – Versuche, eine Atombombe zu bauen, bombardiert. Weder Israel noch z.B. Nordkorea.
- Nein, aber die israelische Regierung behauptet, im Rahmen der Selbstverteidigung gehandelt zu haben, denn man habe Nachweise für Aktionen gehabt, die Iran vorbereitet habe. Ich kann das nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, ob es wahr ist oder nicht, aber so ist die israelische Position. Und wie ich bereits sagte, wird um diese israelische Position eine Debatte unter Rechtswissenschaftlern geführt, deren Meinungen sich 50/50 geteilt haben in „es war vollkommen gerechtfertigt“ und „es war nicht gerechtfertigt“. Aber Tatsache ist, dass das iranische Atomprogramm und das iranische militärische Atomprogramm deutlich zurückgeworfen wurden und – ob es zum Besseren ist oder nicht – das macht den Nahen Osten zu einer sichereren Region.
Um nicht etwas mit eigenen Worten wiederzugeben, wollte ich einige deutsche Rechtsexperten zitieren. Zum Beispiel sagt Kai Ambos, ein angesehener Jurist, Professor für Straf- und Völkerrecht an der Universität Göttingen, seinerzeit Richter am Kosovo-Tribunal in Den Haag: „Im Einklang mit den Voraussetzungen des Rechts auf Selbstverteidigung wie sie in Artikel 51 der VN-Charta definiert sind ist die Anwendung von militärischer Gewalt nur dann gerechtfertigt, wenn der jeweilige Staat einen bewaffneten Angriff durchgeführt hat. In diesem Fall gab es keinen Angriff auf Israel von Seiten Irans. Israel behauptet, sich vor einem künftigen Angriff schützen zu müssen, bei dem möglicherweise Atomwaffen zum Einsatz kommen würden. Aber das basiert ausschließlich auf Vermutungen. Der israelische Angriff gegen Iran war völkerrechtswidrig.“ Außerdem sagt Professor Ambos, dass Israel „die Unvermeidbarkeit eines iranischen Angriffs mit Einsatz von Atomwaffen hätte beweisen müssen“. Somit sei es zum jetzigen Zeitpunkt „nicht möglich zu sagen, dass der Angriff unvermeidlich gewesen ist“. Und noch ein Experte, Professor Matthias Goldmann von der Universität für Wirtschaft und Recht Wiesbaden: „Wie dem auch sei, auch wenn Iran bereits im Besitz von Atomwaffen ist, gerechtfertigt es nicht den Angriff. Der israelische Angriff auf den Iran ist ein klassischer Fall von einem verbotenen Präventivschlag“ und nicht von Selbstverteidigung. Ich stelle diese Fragen so ausführlich, weil Deutschland immer darauf beharrte, das Völkerrecht zu verteidigen, das sei für Deutschland wichtig. Warum hat die Bundesregierung solche Einschätzungen der Völkerrechtler nicht berücksichtigt?
- Das, was Sie eben zitiert haben, belegt genau das, wovon ich spreche. Wir führen intensive Diskussionen. Es gibt Rechtswissenschaftler, die sagen, es sei rechtswidrig gewesen. Es gibt die israelische Regierung, die das Gegenteil behauptet. Somit haben wir eine 50/50-Situation, in der die einen sagen, es war legitim, und die anderen – das war es nicht. Sie zitieren Kai Ambos, er ist wirklich ein hoch angesehener Wissenschaftler, seine Position ist zu respektieren, und er sagt, man könne auf Artikel 51 erst nach Beginn des Angriffs zurückgreifen. Nun, im Fall von Atombomben ist es eine ziemlich schwierige Position, und deshalb besteht Israel auf seinem Recht, bei so etwas vorzubeugen, das rechtfertigt sein Vorgehen im Einklang mit Artikel 51 der VN-Charta. Nochmal, es ist ein juristisches Argument. Sie können sich auf die eine oder die die andere Position stellen. Unsere Position ist eine politische und analytische. Wir sagen, dass in der Folge – unabhängig von unseren rechtlichen Einschätzungen – der Nahe Osten eine sicherere Region geworden ist als zuvor.
Übrigens kommt Professor Ambos zum gegenteiligen Schluss, er ist der Meinung, dass der Nahe Osten infolge der Angriffe weniger sicher geworden ist. Und außerdem sagt er: „Deutschland und die EU müssen klar bekennen, dass dieser Angriff ein Verstoß gegen das Völkerrecht war“, ansonsten sei es Wasser auf die Mühlen Moskaus, das alle Argumente in der Hand habe, um dem Westen vorzuwerfen, er habe einen Völkerrechtsbruch unterstützt. Und wir sehen, dass genau das passiert.
- Nochmal, er ist Wissenschaftler und hat das Recht auf eigene Meinung. Bei uns in Deutschland, wie übrigens auch überall im Westen, wird darüber frei diskutiert. Ich denke, ich würde bei seiner politischen Analyse nicht mitgehen. Seine juristische Analyse will ich nicht kommentieren, weil die Debatte noch im Gang ist. Aber ich glaube, seine Behauptung, der Nahe Osten sei jetzt weniger sicher, ist eine falsche politische Schlussfolgerung. Die Möglichkeit für den Iran, in den Besitz einer Atombombe zu gelangen, und seine Absicht, Israel auszulöschen, ist meines Erachtens eine derart gefährliche Kombination, dass wir die israelische Position uns zumindest anhören und sie genauso eingehend analysieren sollten wie Herr Ambos seine juristischen Ansichten analysiert.
Aber auch andere Völkerrechtler, die ich gelesen habe, sagen, dass eine „existenzielle Bedrohung“ nicht unter die Definition von Aggression fällt. Und sogar die Erklärungen, dass das „zionistische Gebilde vernichtet werden“ müsse…
- Ich erlaube mir, Sie an diesem Punkt zu unterbrechen. Aus dem 20. Jahrhundert haben wir die Lehre gezogen, dass es sinnvoll ist zuzuhören, wenn jemand sagt, was er vorhat. Wie Sie wissen, hat Hitler „Mein Kampf“ veröffentlicht, und man hat es nicht ernst genommen. Und wir wissen, wozu es geführt hat: ein schrecklicher Weltkrieg, Holocaust, eine absolute Katastrophe für die Weltgeschichte, weil Menschen nicht ernst genommen haben, was er sagte. Heute, wenn die Iraner sagen, sie wollen alle Israelis töten und Israel auslöschen, haben wir zwei Möglichkeiten: Wir können es ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Und wir nehmen es wirklich ernst. Und deshalb denke ich – unabhängig davon, welche rechtlichen Argumente ins Feld geführt werden, wie ich bereits sagte –, dass es sinnvoll ist, die Argumentation Israels mit einem gewissen Vertrauen zur Kenntnis zu nehmen, weil wir das, was die Iraner sagen, ernst nehmen sollten.
Richtig. Aber in der Folge hat Israel seine Zusammenarbeit mit der IAEA aufgekündigt. Ich glaube, dass das sehr schlecht für alle ist.
- Sie meinen Iran.
Ja, natürlich, Iran, Verzeihung. Und ich möchte hier den Generaldirektor der IAEA Rafael Grossi zitieren, der eingeräumt hat, dass Iran zum Zeitpunkt des israelischen Angriffs nicht in der Lage war, eine Atombombe zu bauen. „Viele haben gesagt, ihr müsst in eurem Bericht sagen, dass der Iran im Besitz von Atomwaffen ist oder sehr nah dran ist, Atomwaffen zu bauen. Aber das haben wir nicht getan, weil es nicht dem entspricht, was wir gesehen haben.“ Erinnert es Sie nicht an die berühmte Szene mit Colin Powell und dem Reagenzrohr vor der VN-Generalversammlung, das als Begründung für die Invasion in den Irak herangezogen wurde?
- Nein, nein, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Obwohl wir jetzt eher über Lehren aus der Geschichte als über die politische Situation sprechen, bin ich nicht damit einverstanden. Das, was Colin Powell vorgelegt hat, waren gefälschte Beweise, die es einfach nicht gab. Aber es gibt keine Zweifel daran, dass Iran gegen seine Verpflichtungen verstoßen und Uran bis zu einem Grad angereichert hat, der für zivile Programme nicht notwendig ist. Sie haben immer gesagt: Wir entwickeln nur das zivile Programm, unsere ganzen Aktivitäten im Nuklearbereich sind friedlicher Natur, es geht um Energieerzeugung für die zivile Nutzung, für medizinische Zwecke und Ähnliches. Aber dafür braucht man keine Anreicherung auf 60%. Dazu gibt es absolut keinen Grund. Wieso strebt man dann eine 60%-ige Anreicherung an? Weil bei einer Anreicherung auf 90% – und technisch blieb bis dahin nur ein kleiner Schritt – man dieses Material für Atombomben nutzen kann. Und nochmal: Absichten haben eine Bedeutung. Erklärte Absichten haben eine Bedeutung. Wenn ich israelischer Politiker wäre, würde ich es sehr ernst nehmen, wenn jemand sagen würde, er wolle Israel als Staat vernichten, auslöschen. Was die unterschiedlichen Definitionen betrifft: War es eine präventive Aktion? Oder eine präemptive? Oder war es Selbstverteidigung? Das müssen Rechtswissenschaftler ausdiskutieren, und diese Diskussion kann offen geführt werden. Ich bin genauso gespannt wie Sie, wie diese Diskussion enden wird, zu welchem Ergebnis sie führen wird. Im Moment ist sie sehr lebhaft, und wir wissen nicht, was am Ende herauskommen wird.
Sowohl Deutschland als auch Russland gehörten der Sechsergruppe an, die Atomverhandlungen mit Iran geführt hat. Besprechen deutsche Diplomaten zurzeit mit ihren russischen Kollegen, was man in dieser Situation zusammen tun könnte?
- Der deutsche Außenminister hat gerade mit dem iranischen Außenminister gesprochen. Das heißt, der Kontakt ist da, der Austausch ist da. Weil wir wollen, dass Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt, und es absolut notwendig ist, dass er es tut. Wenn sie ein ziviles Programm entwickeln, wenn sie ihre Verpflichtungen erfüllen, wird niemand etwas dagegen haben. In der Vergangenheit hat Russland geholfen, indem es das Spaltmaterial herausgebracht hat, welches die Iraner zuvor hergestellt hatten. Deshalb glaube ich, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass Frankreich, Großbritannien, Deutschland, die USA, China und Russland sich zusammentun und die Iraner versuchen zu überzeugen erstens Verhandlungen zu führen und zweitens die Kernenergie ausschließlich zu zivilen Zwecken zu nutzen wie sie es immer versprochen haben. Aber wissen Sie, daran gab es begründete Zweifel.
Das heißt, deutsche und russische Diplomaten stehen dazu nicht in Kontakt?
- Ich habe keine Informationen zu irgendwelchen Kontakten, die aktuell stattfinden. Was nicht bedeutet, dass es künftig keinen Austausch zu diesem konkreten Thema geben kann.
Herr Lambsdorff, welche Fragen gibt es überhaupt noch, die Deutschland und Russland weiterhin über diplomatische Kanäle besprechen?
- Ich will sagen, dass wir aktuell eine sehr begrenzte bilaterale Agenda haben. Das wichtigste Thema ist natürlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, und wir sagen unseren russischen Kollegen immer wieder, dass dieser Krieg enden muss, wir aber einen gerechten und dauerhaften Frieden brauchen. Ich denke, dass das heutzutage ein vorrangiges Thema ist. Das sagen wir über alle Kanäle. Und es gibt noch einige bilaterale Fragen, über die wir sprechen. Es freut mich sagen zu können, dass wir einige Formen der Zusammenarbeit erhalten haben. Zum Beispiel die Pflege von Kriegsgräbern, die es sowohl in Deutschland als auch in Russland gibt. Das heißt, es gibt einige Dinge, die globalen Charakter haben, und es gibt Dinge, die ausschließlich bilateral sind.
Was sagt Ihre Beobachtung, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, haben sie sich in den vergangenen zwei Jahren verschlechtert? Oder stagnieren sie einfach?
- Ich meine, das Hauptthema ist der Krieg. Der Krieg ist nicht zu Ende. Russland führt seine Angriffe weiter. Alleine in der vergangenen Nacht wurden 728 Drohnen gestartet, sechs oder sieben Marschflugkörper, meine ich, eine Kinschal-Rakete. Russland attackiert weiter die Ukraine, einen souveränen Staat in Europa, auf unserem Kontinent. Wir haben in Deutschland eine Million ukrainische Flüchtlinge. Daher würde ich die Beziehungen nicht als gut bezeichnen, aber in den vergangenen zwei Jahren sind sie nicht wesentlich schlechter geworden, denn den Krieg gab es schon vorher.
Roderich Kiesewetter, Mitglied des Bundestags und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, hat in seinem Interview der Zeitung Handelsblatt zum Beispiel kürzlich dazu aufgerufen, alle russischen Diplomaten aus Deutschland auszuweisen. „Alle noch verbleibenden Agenten und Diplomaten müssen gehen“, - sagte er und rief auch dazu auf, das Russische Haus in Berlin zu schließen. Erschweren solche Aufrufe nicht Ihre Arbeit hier?
- Ach, ich kenne Roderich sehr gut, weil wir in diesem Gremium zusammengearbeitet haben. Ich habe eine andere Meinung, sonst wäre ich nicht hier. Aber er ist ein überzeugter Verfechter dieser Position und hat es in seinem Interview deutlich gemacht. Ich denke, unsere Regierung sieht es anders und deshalb bin ich hier. Deshalb ist auch mein Kollege Sergej Netschajew in Berlin. Wir werden die diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten, auch wenn Roderich da anderer Meinung sein mag.
Aber glauben Sie, dass das Russische Haus in Berlin geschlossen werden könnte?
- Wir haben einen Vertrag, ein Abkommen, das diesen Bereich regelt.
Eine ganz frische Nachricht: Bundeskanzler Merz sagte, dass die diplomatischen Möglichkeiten der Lösung des Ukraine-Konflikts „ausgeschöpft“ seien, seine Worte werden von Reuters zitiert. Aber es sieht so aus, dass er es nicht einmal versucht hat. Zum Beispiel hat der französische Präsident Emmanuel Macron plötzlich Wladimir Putin angerufen und sie haben zwei Stunden miteinander geredet. Donald Trump setzt sich seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus immer wieder mit dem russischen Präsidenten in Verbindung. Und wir sehen bereits gewisse Folgen davon. Sogar der neue Papst hat schon mit Wladimir Putin telefoniert, wobei, wie uns der russische Botschafter im Vatikan erzählte, die Initiative da von Moskau ausging. Wie dem auch sei, solche Versuche werden unternommen. Warum hat Friedrich Merz, der an der Spitze eines der führenden Länder der EU steht, bisher nicht die Möglichkeit genutzt, mit Wladimir Putin zu reden? Was denken Sie?
- Nun, der Grund ist sehr einfach und interessant… Nach seinem Gespräch mit Präsident Putin hat Präsident Macon natürlich den Bundeskanzler angerufen. Ich kann nur vermuten, was er dem Bundeskanzler gesagt hat, nämlich dass der Kreml keine ernsthaften Absichten hat, den Krieg zu beenden. Zu genau dieser Schlussfolgerung ist jetzt das Weiße Haus gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, was Präsident Trump gestern gesagt hat. Er hat, wie soll ich sagen, recht drastische Ausdrücke benutzt, um den Inhalt seiner Gespräche mit Präsident Putin zu beschreiben. Eigentlich hat Trump gesagt, dass sie letztendlich sinnlos waren, dass Präsident Putin freundlich ist, die Gespräche sich aber in Wirklichkeit als sinnlos erweisen. Daher meine ich, dass man jetzt überall in der Welt zu dem Schluss gekommen ist, dass Russland keine Absichten hat, den Krieg zu beenden. Der Bundeskanzler ist natürlich immer offen für ernsthafte Gespräche, aber nicht für Gespräche, die sich am Ende als sinnlos erweisen.
Aber kann so ein Gespräch nicht doch von praktischem Nutzen sein? Zum Beispiel hat Deutschland im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle beim multilateralen Gefangenenaustausch gespielt. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber wir können vermuten, dass der Austausch nicht stattgefunden hätte, wenn Präsident Putin und Kanzler Scholz sich nicht persönlich gekannt hätten. Was denken Sie?
- Nun, ich schließe nicht aus, dass ein Gespräch zu aktuellen Themen stattfindet. Aber wenn Sie nach einem Gespräch des Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten zu dem Thema fragen, das die internationale Agenda beherrscht, nämlich zum russischen Angriffskrieg, dann gibt es absolut keine Anzeichen dafür, dass Russland ernsthaft bereit ist – und ich unterstreiche das Wort „ernsthaft“ –, dass Präsident Putin ernsthafte Absichten hat, dem Krieg ein Ende zu setzen. Ich meine, wir sehen es entlang der ganzen Frontlinie von Sumy bis Cherson. Russische Einheiten rücken weiter vor. Wir sehen es an den Angriffen auf die ukrainischen Städte. Wir sehen überhaupt keine Anzeichen für eine Planänderung. Wir sehen es an den Interviews z.B. von Außenminister Lawrow für verschiedene Medien. Es hat sich sehr wenig geändert im Vergleich zu der Rede, die der Präsident Mitte Juni vergangenen Jahres vor Mitarbeitern des Außenministeriums gehalten hat und in der er das dargelegt hat, was wir für Maximalpositionen und für äußerst unrealistisch halten. Das heißt, ich glaube, dass wenn es ein aktuelles Problem gibt, ein Kontakt oder ein Gespräch stattfinden kann. Aber bei der wichtigsten Frage bewegt sich der Kreml nicht, und deshalb hat es für den Bundeskanzler keinen Sinn, jetzt mit dem Präsidenten zu sprechen.
Kann es sein, dass Außenminister Johann Wadephul am Rande der VN-Generalversammlung im September mit Sergej Lawrow spricht?
- Das kann ich nicht ausschließen, aber das entscheidet der Minister. Ich bin der Botschafter. Und die Entscheidung trifft der Minister in Berlin oder später in New York. Aber im Moment wiederholt der russische Außenminister, der, wie Sie wissen, ein sehr erfahrener Kollege ist, im Wesentlichen nur das, was der Präsident vor 13 Monaten im Juni gesagt hat. Das ist natürlich nicht seriös. Man kann nicht auf der Grundlage dieses so zu sagen Forderungskatalogs arbeiten, das ist nicht möglich.
Dreieinhalb Jahre sind seit Beginn des vollumfänglichen militärischen Konflikts in der Ukraine vergangen. Es gibt keinen Durchbruch, den man im Westen erwartet hat. Russland verliert nicht. Russland rückt langsam vorwärts. Die Ukraine gewinnt nicht, und wir sehen, dass die Zeit gegen die Ukraine spielt. Deutschland und andere EU-Länder unterstützen die Ukraine, wiederholen aber dabei, dass sie nicht Teil des militärischen Konflikts werden wollen. „Wir sind nicht Kriegspartei“, - das sagte Olaf Scholz und das Gleiche sagt jetzt Friedrich Merz.
- Das bleibt unsere Haltung, ganz genau.
Was will Deutschland in dieser Lage tun? Die Lage ist offensichtlich ernst, aber was weiter?
- Ich meine, Russland ist in die Ukraine eingedrungen, die Ukraine verteidigt sich, verteidigt ihre Souveränität, ihre territoriale Unversehrtheit, sie kämpft ums Überleben. Und nicht nur Deutschland, sondern sehr viele Staaten unterstützen die Ukraine, damit sie von ihrem Recht gemäß Artikel 51 der VN-Charta, nämlich von dem Recht auf Selbstverteidigung, Gebrauch machen kann. Und wir werden es weiter tun. Just heute haben im Bundestag Debatten stattgefunden, bei denen der Bundeskanzler diese Position bestätigt hat. Deshalb denke ich, dass die Antwort auf die Frage danach, was Deutschland tun wird, die ist, dass Deutschland seine Politik der Unterstützung der Ukraine mit ihren legitimen Rechten fortführen wird.
Deutschland unterstützt die Ukraine mit Waffen. Aber was passiert, wenn der Ukraine die Menschen ausgehen, wenn sie niemanden mehr hat, der kämpfen kann? Hat Berlin eine Antwort auf diese Frage?
- Interessant, dass, wie Moskowski komsomolez heute schreibt, sich in der Ukraine eine Million Soldaten an der Front befinden. Und die Mobilisierung von jungen Menschen im Alter von 18-25 Jahren hat in der Ukraine noch gar nicht begonnen. Deshalb denke ich, dass manche Analysten hier in Russland mit übertriebenem Optimismus davon sprechen, dass der Ukraine Menschen fehlen. Ich denke, die Ukraine verteidigt sich aktuell wirklich heldenhaft gegen diesen Angriff. Und wir erwarten nicht, dass es sich ändert, wenn man bedenkt, dass sie Ressourcen dafür haben. Zugleich sehen wir einen langsamen, aber stetigen Niedergang der russischen Wirtschaft, und deshalb wird es spannend sein zu sehen, wie lange die russische Wirtschaft diese Kampfhandlungen aushalten kann. Die Inflation hier ist sehr hoch. Der Lebensstandard der Menschen sinkt. Die zivile Produktion ist nicht vorhanden, wissen Sie. All das wird durch den Rüstungssektor ersetzt. Ich meine, dass Russland in dieser Lage auf sich schauen sollte und nicht auf die Ukraine.
Wenn ich mich nicht irre, hat auch der ukrainische Präsident Wladimir Selensky von dem Problem mit dem menschlichen Faktor gesprochen. Aber ich rede nicht vom Optimismus, im Gegenteil, ich rede davon, dass die Lage sehr ernst ist. Bedeutet es, dass Deutschland immer noch an eine Lösung des militärischen Konflikts auf dem Schlachtfeld glaubt?
- Wir haben nie an eine Lösung des Konflikts auf dem Schlachtfeld in dem Sinne geglaubt, dass man auf dem Schlachtfeld zu einem gerechten und dauerhaften Frieden kommen kann. Es werden Verhandlungen notwendig sein, die beide Parteien ernsthaft und auf der Grundlage des Völkerrechts werden führen müssen, um zu einem Abkommen zu gelangen, das dieser schrecklichen Situation mit täglichen Morden in der Ukraine ein Ende setzen wird. Wenn es von uns abhängen würde, wäre uns nicht einmal in den Sinn gekommen, diesen Konflikt auf dem Schlachtfeld zu lösen. Das war die alleinige Entscheidung Russlands, eine Invasion zu starten, und nur sie hat ein Schlachtfeld geschaffen. Und bis heute bleibt es ganz einfach, aber wahr: Sobald Russland den Krieg stoppt, wird der Krieg enden. Und für den Präsidenten dieses Landes ist es nur ein einziger Befehl zu sagen, er sei offen für eine Beendigung des Krieges etc. Er müsste einen einzigen Befehl geben, das Schießen und das Töten einzustellen, dann wird der Krieg zu Ende sein.
Halten Sie es für möglich, dass Versuche, Moskau und Kyjiw an den Verhandlungstisch zu bringen, so wie Donald Trump sie gerade unternimmt, funktionieren können? Und dass die Parteien möglicherweise einen Kompromiss werden finden müssen, um Frieden zu erreichen?
- Daran besteht kein Zweifel. Ich meine, der Krieg wird schließlich so oder so enden, in der einen oder anderen Form, und dazu werden beide Seiten nach einem Weg suchen, den militärischen Konflikt zu lösen. Wie es im Detail aussehen wird, hängt von den Parteien ab. Aber wir sagen immer: Um dem Konflikt ein Ende zu setzen, braucht es einen gerechten, dauerhaften Frieden auf der Grundlage des Völkerrechts. Russland sagt aber, dass die Gegebenheiten auf dem Boden anerkannt werden müssten und Veränderungen in der ukrainischen Innenpolitik notwendig seien. All das hat keine rechtliche Grundlage, keine völkerrechtliche Begründung, deshalb denke ich, dass wir da noch weit auseinander liegen. Und zurzeit kann ich schwer eine Annäherung der Positionen absehen.
Es scheint, dass Trump bei seinen Versuchen weniger an das Völkerrecht appelliert, sondern sich eher auf praktische Überlegungen stützt, wie es aussieht.
- Mag sein, das ist Sache des amerikanischen Präsidenten, aber im Augenblick – wenn man seine gestrige Erklärung für bare Münze nimmt – glaube ich, dass er die Hoffnung aufgegeben hat, dass Präsident Putin an einer Lösung für den Krieg interessiert ist, und seine Politik hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine sehr bald ändern könnte. Wir werden sehen.
Dabei ist völlig unklar, was mit der amerikanischen militärischen Unterstützung der Ukraine sein wird. Es gibt widersprüchliche Signale. Zunächst stoppt Trump die Lieferungen, dann sagt er, er werde sie teilweise wieder aufnehmen. Vor ein paar Tagen sagte er, die USA würden der Ukraine 10 Raketen für das Luftabwehrsystem Patriot liefern. Ich habe dazu einen Journalisten und Militärexperten befragt. Er bestätigte, dass diese Raketen sehr teuer und nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind, sie würden für etwa 24 Stunden reichen. Es gab Medienberichte darüber, dass Deutschland möglicherweise einen Deal mit den USA schließen und einige Patriot-Systeme für die Ukraine kaufen will. Ist es wahr, dass Deutschland es tun will?
- Nun ja, darüber wurde gesprochen, aber ich will nicht über einzelne Systeme reden. Wichtig hier ist, dass die Luftabwehr überlebensnotwendig für die Ukraine und die Menschen dort ist. Weil Nacht für Nacht hunderte russische Drohnen ukrainische Städte angreifen. Und zum Schutz vor diesen Drohnen, vor Marschflugkörpern und ballistischen Raketen ist die Luftverteidigung wahrscheinlich das Dringendste, was die Ukraine braucht. Deutschland verfügt über sehr gute Technologien in diesem Bereich, und wir haben die Initiative ergriffen und alle europäischen Länder aufgerufen, sich zusammenzutun, um die Ukraine dabei zu unterstützen, ihren Luftraum zu verteidigen, und wir werden es auch weiter tun.
Übrigens räumte der deutsche Verteidigungsminister, Boris Pistorius, im April ein, dass Berlin vorerst nicht in der Lage ist, der Ukraine weiter Patriot-Systeme zu liefern, weil die Deutschen selbst eine Lieferung nicht vor 2027 erwarteten und bereits ein Viertel ihrer eigenen Systeme an Kyjiw abgegeben hätten. Und dann gab es noch Berichte darüber, dass Deutschland bereit sei, ältere PAC-2-Raketen mit der Ukraine zu teilen, nicht die PC-3, die es selbst brauche.
- Hier ist eins wichtig: Wir haben unsere Politik so geändert, dass wir nicht mehr über einzelne Systeme reden, deshalb werden wir nicht über Patriot, Leopard oder sonst etwas sprechen. Die Stoßrichtung der Politik, das ist das, was von Bedeutung ist. Und diese besteht darin, dass die Luftverteidigung einen zentralen Platz einnimmt, die deutsche Unterstützung bleibt stark, wir werden die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine weiter stärken, auch mit anderen Systemen, die Rede ist nicht nur von Patriot. Und noch etwas wollte ich unterstreichen, was, wie ich denke, wichtig zu verstehen ist. Die ukrainische Rüstungsindustrie hat sich notgedrungen rasant entwickelt und produziert jetzt viele Systeme selbst, deshalb geht es nicht mehr alleine um Lieferungen. Es geht darum, was die Ukrainer selbst in der Lage sind herzustellen, zum Beispiel was den Drohnenkrieg angeht. Die Ukrainer erzielen sehr große Erfolge in einigen Bereichen der Verteidigung, zum Beispiel kann man sehen, wie FPV-Drohnen im Kampf eingesetzt werden. Und wie Sie selbst schon sagten, die russische Armee rückt sehr langsam, Stück für Stück vor, und das hängt damit zusammen, dass die Frontlinie natürlich…
Ich sagte nur Stück für Stück, ich bin keine Militärexpertin.
- Das stimmt.
Aber ich habe nicht vom langsamen Vorrücken gesprochen. Ich sagte, Russland rückt vor.
- Ja, Russland rückt vor, aber langsam, sehr langsam. Nehmen Sie z. B. Pokrowsk, dort sitzen sie schon seit sieben Monaten. Oder Luhansk: Vor Kurzem erst gab es eine TASS-Meldung, Luhansk werde jetzt zu 100% durch die russischen Streitkräfte kontrolliert. Das hat eine Ewigkeit gedauert, dieser letzte Prozentpunkt, weil sie ursprünglich 99% kontrollierten. Die russische Infanterie und die Panzereinheiten rücken sehr, sehr langsam vor, weil die Ukrainer gelernt haben, das Schlachtfeld gut zu kontrollieren, wenn sie angegriffen werden. Wenn man also nachrechnet, wird man feststellen, wie viel Zeit die russische Armee brauchen wird, um die restlichen Teile des Donbass und Saporishshja oder die Region Cherson wirklich zu erobern. Das würde eine Ewigkeit dauern.
Ja, das ist es ja, der militärische Konflikt kann sich über Jahre hinziehen.
- Und deshalb sagen wir: Präsident Putin, stoppen Sie den Krieg. Sie können den Krieg stoppen, indem Sie einen einzigen Befehl erteilen. Stoppen Sie ihn einfach.
Sie sagten, Sie wollen nicht über konkrete Waffensysteme sprechen. Hat es mit der Entscheidung der deutschen Regierung zu tun, Informationen über konkrete Waffenlieferungen an die Ukraine als vertraulich einzustufen?
- Ja, das stimmt.
Das heißt, es gilt auch für die Taurus-Raketen, die die Ukraine sehr gerne von Deutschland bekommen würde.
- Ja, es gilt genauso, wir reden nicht über konkrete Systeme, sei es Patriot, seien es andere, auch Taurus. Darüber reden wir nicht mehr.
Das heißt, es ist nicht mehr Teil der öffentlichen Diskussion in Deutschland?
- Nein, in Wirklichkeit reden wir über eine Reihe von anderen Dingen. Gerade heute hatten wir Haushaltsdebatten. Der Kanzler hat eine lange Rede gehalten, die Opposition war sehr angriffslustig. Es war eine intensive Auseinandersetzung, wissen Sie, eine demokratische Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung in unserem Parlament, so wie es sich in einem richtigen Parlament gehört. Und natürlich ging es da um Prioritäten der Regierung in Bezug auf die Investitionen in die Infrastruktur, um die Stärkung unserer Streitkräfte, Sozialausgaben, Steigerung der Mütterrente und so weiter. Sehr viele Fragen werden diskutiert. Zum Beispiel der Klimawandel, weil wir in Deutschland eine Zeit lang sehr heißes Wetter hatten, wie auch in Moskau. Aber wie Sie sagten, es stimmt, konkrete Waffensysteme sind nicht mehr vorrangiger Gegenstand der Debatte.
Nun, Friedrich Merz hat Kanzler Scholz für mangelnde Entschlossenheit in Bezug auf die Lieferung von weitreichenden Raketen kritisiert. Aber seitdem er selbst an der Macht ist, handelt er genauso.
- Sie wissen sicherlich, dass bei uns Wahlen stattgefunden haben, Scholz hat kandidiert, Merz hat kandidiert, und niemand wusste, wer der Sieger sein würde. So wie es eben bei demokratischen Wahlen sein muss. Hier ist alles ein bisschen anders, man weiß ziemlich genau, wer die Wahlen gewinnen würde. Und als Merz gewann, hat er die Fakten analysiert und die Entscheidung getroffen, dass der Prozess nicht mehr öffentlich sein soll, so kam es dazu. Ob man es als Unentschlossenheit oder als Weisheit bezeichnet – das können Sie entscheiden.
Ich denke, es zeigt, dass es ziemlich leicht ist, etwas aus der Opposition heraus zu sagen, weil man keine Verantwortung für Entscheidungen trägt, und etwas ganz anderes ist es, wenn…
- Da gebe ich Ihnen recht. Ich war 20 Jahre lang Abgeordneter. Im Deutschen Bundestag war ich vier Jahre lang in der Opposition und zweieinhalb in der Regierungskoalition. Es ist viel einfacher, in der Opposition zu sein, da gebe ich Ihnen recht.
Die Aufrufe zum Dialog mit Russland gingen bisher hauptsächlich von der Alternative für Deutschland aus und galten als populistisch. Aber vor Kurzem erschien das Manifest der Sozialdemokraten, veröffentlicht von prominenten SPD-Mitgliedern, Vertretern des linken Flügels der Partei. Unter den Unterzeichnern finden sich einige amtierende Abgeordnete sowie Veteranen der SPD. Sie rufen zur Abrüstung auf, die zur Grundlage der neuen Außenpolitik werden solle. Und sie rufen zur Entspannung in den Beziehungen zu Russland auf. Bedeutet es, dass solche Aufrufe zum Dialog mit Russland in Deutschland nicht mehr marginal sind?
- Nein, im Gegenteil. In Wirklichkeit gingen sie erstens nicht nur von der AfD aus. Es gab auch andere Stimmen aus akademischen Kreisen, und eine andere Partei, die sehr nahe dran war, in den Bundestag einzuziehen, hat auch dazu aufgerufen. Es gibt einen Länderchef aus der Partei von Friedrich Merz, Michael Kretschmer aus Sachsen, der auch diese Ansichten vertritt. Das heißt, wir hatten Diskussionen darüber. Aber vor Kurzem haben Wahlen stattgefunden und diese Wahlen haben Parteien gewonnen, die sehr klar sagen: Wir setzen die Unterstützung der Ukraine fort. Unter den Sozialdemokraten und den Christdemokraten und auch in anderen Parteien gibt es Stimmen gegen die allgemeine Linie dieser Parteien. Und das ist ganz normal in einer Demokratie. Zwei der einflussreichsten Sozialdemokraten, der Parteivorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil und der Verteidigungsminister und beliebtester Sozialdemokrat Boris Pistorius, habe das Manifest sehr schnell abgelehnt. Beide haben gesagt, dass es nicht seriös sei, dass es ein schlechtes Papier sei. Ich will nicht zu tief in dies Diskussionen einsteigen, aber die Sozialdemokraten hatten gerade ihren Parteitag, und das Papier hat dort überhaupt keine Rolle gespielt.
Das heißt, Sie halten es für eine marginale Initiative?
- Ja, marginal.
Dann reden wir über einige andere Diskussionen. Wie ich verstehe, sind sie nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte in Deutschland in dem Sinne, dass die Deutschen keinen Einfluss darauf haben. Es geht um Militärausgaben. Experten räumen ein, dass Deutschland eines der Länder ist, welches bei den Verteidigungsausgaben die neue Marke von 5% BIP erreichen kann. Genauer gesagt 3,5% für unmittelbare Militärausgaben. Aber dafür müsste Deutschland bis 2029 seine Militärausgaben verdreifachen – auf 153 Milliarden Euro. Ist Deutschland dazu bereit? Sind die Deutschen dazu bereit?
- Ja.
Aber es wird auf Kosten der Sozialausgaben gehen.
- Ich bin sehr froh, dass wir dieses Interview gerade heute aufzeichnen. Denn just heute Morgen hat es der Bundeskanzler gesagt, hat es der Finanzminister gesagt, der Verteidigungsminister gesagt, und interessanterweise haben alle anderen Minister, für Soziales, für Verkehr, sie alle haben zugestimmt. Somit ist die Antwort auf diese Frage sehr einfach und sie wurde heute bestätigt: Ja, Deutschland ist bereit
Und die Deutschen?
- Nun, die Deutschen. Wenn Sie die Wahlergebnisse als Kriterium nehmen, was wir in einer Demokratie auch tun sollten, dann wird die Antwort auch ja sein. Werden alle damit einverstanden sein? Nein. Werden diejenigen, die nicht einverstanden sind, lauter sein als diejenigen, die einverstanden sind? Ja. Wir werden also weiterhin eine Diskussion über die Prioritäten unserer Ausgabenpolitik haben. Aber der Deutsche Bundestag, unsere Legislative, die Haushaltsentscheidungen trifft, ist darauf vorbereitet, und der Bundestag repräsentiert das deutsche Volk. Das heißt, die Antwort auf die zweite Frage nach den Deutschen lautet auch ja.
Hier in Moskau heißt es oft, dass die Popularität der AfD, die als zweite Kraft aus den jüngsten Wahlen in den Bundestag hervorgegangen ist, unter anderem mit der Kriegsmüdigkeit der Deutschen, der Gesellschaft zu tun hat.
- Es gibt eine Reihe von Problemen. Es gibt eine Reihe von Problemen, aus denen sich die Popularität der AfD erklärt, vor allem in einigen Regionen. Wenn Sie sich die Wahlkarte Deutschlands anschauen – ich will hier nicht allzu ausführlich auf die Qualität der Innenpolitik eingehen, dann das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich als Botschafter –, ist es sehr interessant zu sehen, wo die AfD im Westen Deutschlands erfolgreich war. Sie ist recht erfolgreich im Osten aus Gründen, die mit deutscher Geschichte zu tun haben, mit der Wiedervereinigung und mit allem, was danach kam. Aber im Westen gibt es einige Gebiete, sehr kleine Gebiete, wo die AfD erfolgreich war. Und es hat ganz offensichtlich nichts mit dem Krieg zu tun, sondern hängt mit sozialen Problemen, mit der Sozialpolitik, mit der Schaffung von Arbeitsplätzen, mit Wettbewerbsfähigkeit, mit dem allgemeinen Gefühl des Optimismus oder des Pessimismus zusammen. Wenn Menschen eher optimistisch sind, wählen sie nicht die AfD, wenn sie eher pessimistisch sind, wählen sie in der Regel die AfD. Kaiserslautern, Gelsenkirchen, Mannheim – wichtige Städte im Westen Deutschlands, die einige soziale und wirtschaftliche Probleme haben, – das sind diese Gebiete, wo die AfD erfolgreich ist. Aber es hat nichts mit dem Krieg zu tun.
Und warum sind die Deutschen so pessimistisch geworden, dass Sie – Entschuldigung – nicht mehr für Ihre Partei, für die Freien Demokraten stimmen?
- Ich vertrete hier keine Partei.
Ja, das weiß ich.
- Sie stimmen nicht mehr… Nehmen wir zum Beispiel Mannheim. Das ist eine Hochburg der Sozialdemokraten. Gelsenkirchen ist auch eine sozialdemokratische Hochburg. Und ich glaube, wenn man die Entwicklungen dort analysiert, dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen, zum Beispiel die Deindustrialisierung im Ruhrgebiet, die seit mehr als 20-30 Jahren stattfindet. Und wenn Sie sich Gelsenkirchen und Mannheim anschauen, dann sind es sehr starke Industriezentren, und wir hatten gewisse Probleme in einigen Branchen. Menschen haben Angst vor der Arbeitslosigkeit und wählen deshalb die Partei, die ihnen verspricht, die Situation zu ändern. Ich will nicht kommentieren, ob diese Versprechen begründet sind, das gehört nicht zu meinen Aufgaben, aber so ist die Situation.
Was die Militärausgaben betrifft. Werden die Deutschen ihre Denkweise ändern müssen? Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte in der deutschen Gesellschaft noch so zu sagen die Impfung gegen die Militarisierung. Frieden schaffen ohne Waffen. Die Öffentlichkeit in Deutschland wurde nicht auf neue Kriege vorbereitet. Aber jetzt müssen die Deutschen quasi ihre Mentalität ändern. Was denken Sie darüber?
- Interessant, dass Sie diese Frage stellen, denn ich war selbst zwei Jahre lang Soldat, von 1985 bis 1987, zu Zeiten des Kalten Krieges. Allein in Westdeutschland hatten wir fast eine halbe Million Soldaten. Unsere Ausgaben für die Bundeswehr betrugen 3,5–3,8% des BIP. Weil Kalter Krieg herrschte, war die Bedrohung klar definiert – es war die Sowjetunion, die 1968 in die Tschechoslowakei und 1956 in Ungarn einmarschiert ist, die 1953 den Aufstand in Ostdeutschland unterdrückt hat. Deshalb gab es ein klares Verständnis von der Bedrohung, und das Land war vollkommen bereit, die Freiheit zusammen mit Verbündeten zu verteidigen.
Nach der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges hatten wir 30 Jahre lang die Hoffnung, einen Zustand erreicht zu haben, in dem alle eventuellen Konflikte in Europa friedlich gelöst würden. Und so war es auch bis zur Annexion der Krim – der ersten Landnahme in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die russische Invasion der Ukraine 2022 – den Jugoslawien-Krieg lasse ich jetzt beiseite – war der erste ernsthafte große Landkrieg in Europa. Das heißt, die Bedrohung geht für uns jetzt wieder von Russland aus, und Deutschland passt sich dieser Situation an, natürlich nicht aus freien Stücken.
Zum Beispiel sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, dass jetzt Milliardenbeträge für den Bau von neuen Militärbunkern zur Verfügung gestellt werden müssten.
- Zivilschutzbunkern.
Ja, Zivilschutzbunkern. Aber für den Kriegsfall. Glauben Sie nicht, dass solche Initiativen bloß Ängste in der Öffentlichkeit schüren, wenn die Lage ohnehin schon recht unruhig ist? So wird den Menschen nur noch mehr Angs gemacht.
- Aber es ist besser, der Realität ins Auge zu blicken. Schauen Sie, wir haben bei uns eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder, denn Männer können das Land wegen des Krieges nicht verlassen. Ich selbst habe in meiner Heimatstadt Bonn mich um eine aus der Ukraine geflüchtet Frau gekümmert. Sie erzählte mir, dass ihr Mann und ihr Sohn Militärdienst leisten und dass sie Angst habe, so etwas hätte sie sich nicht vorstellen können. Zum Glück sind wir nicht Kriegspartei, der Krieg findet nicht bei uns statt, aber ich denke, es ist richtig, uns auf eine militärische Ausnahmesituation vorzubereiten, und da können wir uns Finnland als Beispiel nehmen. In Finnland gibt es eine Zivilschutzinfrastruktur, die praktisch die gesamte Bevölkerung umfasst. Natürlich kann man es in einem so großen Land mit relativ kleiner Bevölkerung bewältigen. In Deutschland mit seinen 84 Millionen ist es deutlich schwieriger. Aber wir müssen auch anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, leider.
Halten Sie ein solches Szenario wirklich für realistisch, dass die Deutschen diese Bunker brauchen werden, um sich vor einer russischen Invasion zu schützen?
- Das können wir nicht ausschließen. Natürlich hoffe ich, dass Russland nicht vorhat, die NATO anzugreifen, aber vor der Invasion in der Ukraine hat Russland immer wieder gesagt, dass es nicht vorhat, in die Ukraine einzufallen. Aber trotzdem tat es das. Deshalb können wir uns nicht auf Worte verlassen, die aus dem Kreml kommen. Wir müssen uns Taten anschauen und diese analysieren und daraus Schlüsse ziehen. Wie ich schon sagte, wir würden lieber ganz andere Projekte und Initiativen finanzieren, aber so ist die Lage.
Zur Wirtschaft. Auf dem Tisch liegt nunmehr das 18. Sanktionspaket. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, wurde, glaube ich, das 14. Paket diskutiert, jetzt schon das 18. Aber es wurde durch die Slowakei blockiert. Das Land ist, neben Ungarn, einer der Hauptabnehmer des russischen Gases. Zu welchen Zugeständnissen an Ungarn und die Slowakei ist die EU bereit, um dieses Paket zu verabschieden?
- Hier muss ich mich entschuldigen, weil das eine rein technische Frage ist, die durch unsere Kollegen in Brüssel diskutiert wird. Ich weiß nicht, worum die Slowaken bitten. Ich weiß nicht, was die EU-Kommission hinsichtlich der Angebote bereit ist zu ändern. Also meine ehrliche Antwort auf Ihre Frage: Ich weiß es nicht.
Es sieht so aus, dass die Slowaken die Möglichkeit haben wollen, weiter russisches Gas zu beziehen oder Kompensationszahlungen dafür zu bekommen, vermute ich.
- Wenn die EU-Kommission sich etwas einfallen lässt… Ich meine, in den letzten 10-20 Jahren haben wir das Pipelinesystem angepasst. Früher, als Russland ein verlässlicher Partner war, strömte das ganze Gas immer von Ost nach West. Heute verlaufen die Leitungen in West- und Mitteluropa, einschließlich der Slowakei, von Ost nach West, aber auch von West nach Ost. Und deshalb wäre es wahrscheinlich möglich, der Slowakei ausreichende Mengen an Gas zu garantieren, damit sie leben können, aber das hängt von ihnen selbst ab. Das ist Sache der Kommission und der anderen Mitgliedsstaaten, die in Brüssel eine Entscheidung treffen müssen. Das ist eine sehr technische Sache.
Gut, lassen Sie uns über Pipelines reden. Warum hat Deutschland die Ermittlungen wegen Sabotage an den Nord Stream-Leitungen immer noch nicht abgeschlossen?
- Das weiß ich nicht. Beim letzten Gespräch habe ich Ihnen gesagt: Der Fall liegt beim Staatsanwalt in Karlsruhe, nicht einmal in Berlin. Sie sprechen weder mit der Exekutive, der Regierung, noch mit der Legislative, dem Parlament. Als ich Abgeordneter war, haben wir sehr häufig Anfragen nach Karlsruhe geschickt. Wie läuft das Verfahren? Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr etwas gefunden? Und sie haben immer geantwortet: Wir sind die dritte Gewalt, wir sind unabhängig, wir geben euch diese Informationen nicht. Insofern weiß ich nicht, wo wir stehen.
Nun, ich werde Sie nicht danach fragen, wer Nord Stream gesprengt hat. Aber haben Sie für sich selbst eine Vorstellung davon, wer es getan hat? Wer hat es ausgeführt, welche Länder?
- Nein. Wenn ich eine Kristallkugel hätte und daran reiben könnte, dann würde jemand erscheinen und ich wüsste es. Aber ich weiß es nicht. In Karlsruhe wird man zu irgendeinem Schluss kommen, aber ich weiß nicht, wann es sein wird und mit welchem Ergebnis.
Aber was wird mit diesen Rohren passieren? Mir sind sehr exotische Ideen untergekommen, zum Beispiel hat ein Berliner Architekt und Performance-Künstler vorgeschlagen, die Rohre zu bergen, sie zu zersägen und aus den Fragmenten ein Wohnheim für obdachlose Menschen aus der ganzen Welt zu bauen. Eine friedliche Idee…
- (lacht) Davon habe ich nicht gehört.
Ja, vor einem Jahr vielleicht oder vor ein paar Jahren. Aber im Ernst, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, ein Parteikollege von Kanzler Merz…
- Wir haben ihn erwähnt.
Ja, Sie haben ihn erwähnt. In seinem Interview für Die Zeit brachte er die Idee vor, Nord Stream in Betrieb zu nehmen. Er sagte, ihre Inbetriebnahme könnte ein Mittel, könnte der Schlüssel dazu werden, den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen. Was halten Sie davon?
- Nun ja, er ist ein Landeschef, der Ministerpräsident von Sachsen, und es ist sein gutes Recht, eigene politische Ansichten zu haben. Ich glaube nicht, dass seine Meinung sich mit der Meinung des Kanzlers oder der Regierungsmitglieder deckt. Insofern betrachte ich seine Aussagen als einen Beitrag zur Diskussion, die wir schon früher geführt haben. Und Sie haben mir diese Frage schon gestellt. Ehrlich gesagt, sehe ich momentan keine großen Hoffnungen, dass es passieren könnte.
Einige amerikanische Investoren haben auch ihr Interesse an Nord Stream bekundet. Wäre ein Deal mit den USA realistisch?
- Nun, wenn ich die neue nationale Gesetzgebung und die neue europäische Gesetzgebung richtig einschätze, dann wird die Nutzung dieser Pipelines praktisch nicht mehr möglich sein.
Aber das 18. Sanktionspaket ist noch nicht verabschiedet.
- Ja, aber ich habe 13 Jahre lang in Brüssel gearbeitet. Manchmal brauchte es sogar noch länger. Die EU-Kommission ist bei solchen Dingen sehr geduldig und wird es schließlich zu einem Ende führen, bei dem alle Mitgliedstaaten mit dem gemeinsamen Deal zufrieden sein werden.
Das heißt, diese Rohre werden dort für immer liegen bleiben?
- Es sei denn, jemand wird sie für irgendein interessantes Projekt rausholen… Ich weiß es nicht. Lassen Sie uns ganz offen sein. Nord Stream war in Verbindung mit South Stream ein politisches Projekt Russlands zur Umgehung der Ukraine. Heute verstehen alle, was es für ein Projekt war. Und dich denke, dass in Anbetracht der politischen Gegebenheiten auf unserem Kontinent sehr wenige Länder bereit sein werden, zu ihm zurückzukehren. Meines Erachtens gehört diese Diskussion der Vergangenheit an.
Gut, zum russischen Gas. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó sagte: „Das Bestreben der EU-Länder, ihre eigenen Sanktionen gegen Russland zu umgehen, ist zu einer gesamteuropäischen Sportart geworden“. Vor Kurzem hat die deutsche Umweltschutzorganisation Environmental Action Germany die Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlicht. Darin wird behauptet, dass das deutsche Energieunternehmen SEFE im Jahr 2024 einer der wichtigsten Importeure des russischen Flüssiggases war. Das heißt, Deutschland spielte eine Schlüsselrolle beim Import des russischen LNG in die EU. Das Gas kommt im französischen Hafen Dunkerque an, dann geht es nach Frankreich, Belgien, wird mit anderem Gas vermischt und kommt dann nach Deutschland, auch wenn in geringen Mengen. Ist es wirklich so?
- SEFE bedeutet Securing Energy for Europe, so heißt dieses Unternehmen. Ja, sie importieren gewisse Mengen von LNG, das stimmt. Und wenn – und das ist war, das will ich nicht bestreiten – die Energie in gewöhnliche Gasmoleküle umgewandelt wird, kann man ein norwegisches oder algerisches Molekül nicht von einem russischen unterscheiden. Wenn Sie also fragen, ob es möglich ist, sage ich ja, das ist möglich. Und ich denke, dass eine gewisse Menge von russischem Gas immer noch über dieses System nach Deutschland kommt.
In dem Bericht heißt es, dass russisches LNG, das nach Deutschland kommt, offiziell als belgisches Gas, als Gas aus Belgien deklariert wird. Obwohl alle wissen, dass so etwas wie belgisches Gas nicht existiert. Das wäre wie belarussische Garnelen, so sagt man bei uns scherzhaft.
- (lacht) Ja, ja, so ist das. Das ist wichtig. Ich meine, LNG ist nicht sanktioniert, die Einfuhr von LNG in die Europäische Union ist legal, auch aus Russland. Und deshalb gibt es natürlich all diese Firmen, die sich gegenseitig das Gas verkaufen, bis es beim Endverbraucher ankommt. Und das Gas im europäischen System, belgisches Gas, wie Sie sagen, enthält russische Moleküle, und wir wissen, dass es sie in unserem System gibt. Die EU-Kommission hat, wie Sie wissen, jetzt vorgeschlagen, den Import von russischem Gas bis 2027 einzustellen. Und das ist die nächste Diskussion, die wir in Brüssel in Gang bringen wollen, um zu einer Situation zu kommen, in der es keine russischen Moleküle mehr in unserem System geben wird.
Meinen Sie, es wäre bis 2027 realistisch?
- Nun ja, das wird eine spannende Diskussion. Jetzt haben wir 2025, die EU-Kommission hat noch zwei Jahre Zeit. Ich denke, diese Zeit ist ausreichend, damit alle Mitgliedstaaten sich positionieren.
Deutsche Medien haben in Erfahrung gebracht, dass teure deutsche Autos über Parallelimporte oder möglicherweise über graue Importe nach wie vor nach Russland gelangen. Gibt es da eine Statistik? Wie viele deutsche Waren kommen nach Russland über Parallelimporte?
- Nein, ich glaube nicht, dass es sie gibt, denn wenn es sie gäbe, wäre es etwas merkwürdig. Das würde bedeuten, dass die Grauimporte, die nur halblegal sind, das ist die Definition von Grauimporten, bei irgendeinem Statistikamt erfasst werden. Ich glaube, so etwas findet nicht statt.
Und die Parallelimporte?
- Ich habe keine Statistiken zu Parallelimporten gesehen. Das muss ich meine Wirtschaftsabteilung fragen, ob sie etwas darüber wissen. Aber ich glaube nicht, dass so etwas existiert.
Der deutsche Botschafter bewegt sich durch Moskau in einem deutschen Auto, richtig?
- Natürlich, aber sie werden legal eingeführt, weil diplomatische Vertretungen von den Sanktionen ausgenommen sind. Das trifft auch für unsere russischen Kollegen in Berlin zu.
(lacht) Das heißt, es ist kein Verstoß?
- (lacht) Nein, das ist kein Verstoß.
Herr Botschafter, wir haben noch ein bisschen Zeit, um über Erinnerungskultur zu sprechen. Dieses Jahr feiert die Welt den 80. Jahrestag des Sieges über den Nationalsozialismus in Zweiten Weltkrieg. Leider führen Deutschland und Russland keine gemeinsamen Gedenkveranstaltungen durch. Aber es gibt auch andere Probleme. Das russische Außenministerium erhebt regelmäßig ziemlich ernsthafte Vorwürfe gegen Deutschland. Zuletzt im Zusammenhang mit einem Vorfall auf dem offiziellen Telegram-Kanal der deutschen Botschaft. Dort wurde eine Karte des in Sektoren aufgeteilten Nachkriegsdeutschland veröffentlicht und die sowjetische Fahne war dort im Stil des Dritten Reiches dargestellt. Die Botschaft räumte sehr schnell ein, dass es ein Versehen war. Aber das russische Außenministerium ließ die Gelegenheit nicht verstreichen und erhob wieder Kritik. Eines der Themen hat damit zu tun, dass Deutschland Entschädigungszahlungen an Überlebende der Leningrader Blockade leistet, aber nur an jüdische Überlebende, und „ignoriert damit das Leid anderer Bewohner Leningrads“, wie es aus dem Außenministerium heißt. Was können Sie dazu sagen?
- Nun, das ist ein sehr altes Thema. Es stimmt natürlich nicht, dass wir das Leid der Opfer der Leningrader Blockade ignorieren. Ich war persönlich dort, um anlässlich eines Jahrestages das Andenken zu ehren, um Blumen niederzulegen und mit Zeitzeugen zu sprechen. Wir ignorieren das natürlich nicht. Es ist wahr, dass Juden, weil sie unter den Nationalsozialisten verfolgt wurden, eine Form von Zahlungen erhalten, denn wenn sie auch der Blockade entgangen sind, ihnen trotzdem Verfolgung durch das damalige Nazi-Regimes drohte. Aber das ist ein altes Thema. Mit der Russischen Föderation haben wir vereinbart, was wir in Sankt Petersburg tun, und das ist eine humanitäre Geste für ein Krankenhaus. Und wir setzen diese Arbeit noch immer fort, trotz aller Probleme, die in unserem bilateralen Verhältnis in anderen Bereichen entstehen.
Moskau erinnert auch daran, dass Berlin die Blockade Leningrads nichts als Völkermord anerkennt. Obwohl sie in der ganzen Welt bekannt ist, wie der Holocaust, und die Bezeichnung „blokada Leningrada“ oft ohne Übersetzung verstanden wird. In Deutschland wird das Leid der Blockadeopfer nicht in Frage gestellt, ich erinnere mich an Gespräche mit deutschen Historikern. Warum erkennt Deutschland sie dann nicht als Völkermord an?
- Da würde ich unterscheiden wollen. Die Leningrader Blockade ist in Russland und auf Russisch bekannt. Holocaust ist ein internationaler Terminus, ich glaube, man kann sie nicht gleichsetzen, indem man sagt, es sei das Gleiche. Sie unterscheiden sich. Aber wahr ist, dass Deutschland immer noch für seine Schuld am Holocaust büßt, wir leisten Entschädigungszahlungen an die Opfer. In Sankt Petersburg setzen wir die humanitäre Geste weiter um. Als Botschafter unterstütze ich das trotz aller Schwierigkeiten, und wir setzen diese Geste fort.
Wir erinnern uns, dass einige Politiker aus der AfD widersprüchliche Dinge gesagt haben, zum Beispiel: „Nicht alle, die eine SS-Uniform getragen haben, waren zwangsläufig Verbrecher“. Oder, wie ein ehemaliger Parteichef der AfD, Alexander Gauland, sagte, die Deutschen müssten „stolz auf das sein, was die Wehrmacht im Ersten und im Zweiten Weltkrieg geleistet hat“. Das russische Außenministerium veröffentlichte aber den Link zu einem aktuellen Dokument der Bundeswehr aus dem Jahr 2024. Sein Autor heißt Kai Rohrschneider, Leiter der Abteilung Einsatzbereitschaft und Unterstützung Streitkräfte, später wurde er Befehlshaber des Multinationalen Kommandos Operative Führung der NATO in Ulm. Er verfasste ergänzende Hinweise zu den Richtlinien zum Traditionsverständnis und Traditionspflege der Bundeswehr. In diesem Dokument heißt es, die Bundeswehr dürfe sich auf militärische Exzellenz anderer Epochen, einschließlich des Zweiten Weltkrieges, stützen, was sich nicht nur auf Wehrmachtssoldaten beziehe, die am Widerstand beteiligt waren. Als Beispiele führt er hochrangige Militärs der Wehrmacht und der Luftwaffe. Manche von ihnen haben an der Ostfront gekämpft, einer von ihnen wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Ein Konteradmiral war bei der SS. Das nimmt man in Moskau als Grundlage, um zu sagen, dass Deutschland „ehemalige Verbrecher ehrt“ und die Vergangenheit relativiert. Was können Sie dazu sagen?
- Und auch diese Behauptung stimmt nicht.
Aber es ist doch kein gefälschtes Dokument?
- Nein, aber Sie müssen es im Kontext der Gesamtstruktur der Bundeswehr und der dort vorhandenen Einstellung zu deutschen militärischen Traditionen betrachten. Die Richtlinien selbst, der Runderlass von 2018, zu dem diese ergänzenden Hinweise gehören, sagt ganz unmissverständlich: Die Bundeswehr stütz sich nicht auf die Traditionen der Wehrmacht. Die Wehrmacht wurde von der Regierung für militärische Aggression gegen friedliche Nachbarn genutzt, was ein ungeheuerlicher Verstoß gegen das Völkerrecht war. Es war eine ungeheuerliche Verletzung der Regeln friedlicher Koexistenz auf dem europäischen Kontinent und dann auf der ganzen Welt. Deshalb ist die Wehrmacht nicht die Armee, deren Traditionen die Bundeswehr fortsetzt. Ich denke, das Dokument, auf das Sie sich berufen, bezieht sich nur auf ganz bestimmte lokale Vorgehensweisen von Soldaten auf operativer Ebene. Aber auch so ist es sehr umstritten, und ich denke, dass es auch innerhalb der Bundeswehr so gesehen wird. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir die Verantwortung des Dritten Reiches für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs, der ein Verbrechen war, in vollem Umfang anerkennen. Deshalb wird die Wehrmacht nicht von der Bundeswehr verehrt und die Aussagen von denjenigen hier in Moskau, die das Gegenteil behaupten, entsprechen nicht der Wahrheit.
Ich wollte die Gelegenheit nutzen und Sie nach den Reichsbürgern fragen – eine für mich absolut sonderbare Erscheinung in Deutschland. So etwas gibt es in keinem anderen Land der Welt.
- Oh nein, so etwas gibt es sehr wohl hier in Russland! Ich bekomme Zuschriften. Aber Verzeihung, Katja, fahren Sie fort.
Ich meine, fast 16.000 Menschen im ganzen Land leben in der historischen Vergangenheit – im Deutschen Reich, im Zweiten Reich, in der Weimarer Republik. Sie erkennen das heutige Deutschland mit seinen Grenzen und Gesetzen nicht an, sie haben eigene Pässe. Schwer, sich jemanden in Frankreich vorzustellen, der denkt, er lebe jetzt unter Napoleon, oder in Österreich unter Maria Theresia. In Deutschland nehmen es die Behörden aber sehr ernst, es gab Durchsuchungen bei den Gründern des so genannten Königreichs Deutschland. Was denken Sie, was innerhalb der deutschen Gesellschaft und des deutschen Staates ein so sonderbares Phänomen hervorbringen konnte?
- Nun, wenn wir es als Bewegung bezeichnen, übertreiben wir damit den Maßstab dessen, was es in Wirklichkeit ist. Einige hundert oder sogar tausend in einem Land mit 84 Millionen Einwohnern teilen diese verrückten Theorien. Von der Art, dass Deutschland immer noch ein Königreich ist. Wir sind seit 1871 oder noch länger, das ist jetzt nicht so wichtig, kein Königreich mehr. Es ist sehr lange her. Manche glauben, dass Deutschland bloß eine Körperschaft ist, eine GmbH, sie meinen, es sei nicht einmal ein Staat. Manche von ihnen haben Tatsächlich Waffen in die Hand genommen, haben Waffenverstecke eingerichtet, Aufklärung im Bundestag betrieben, wo sie einen Putsch organisieren wollten. Diese Menschen wurden festgenommen und stehen jetzt vor Gericht. Es ist in der Tat eine merkwürdige Erscheinung und ich kann Ihnen nicht erklären, warum sie so denken, weil es ein völliger Quatsch ist. Aber ich wollte Ihnen etwas erzählen, weil Sie sagen, dass es so etwas nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Ich bekomme Briefe, sie kommen hierher, in mein Büro in Moskau, in die deutsche Botschaft, von Menschen, die behaupten, sie seien Vertreter der Sowjetunion, die nie aufgehört habe zu existieren. Und sie sprechen im Namen der Sowjetunion, und wissen Sie, in ihren Vorstellungen ist die ganze Nomenklatura, sind die Einrichtungen immer noch sowjetisch. Sie behaupten, dass sie im Namen des Politbüros sprechen, des Obersten Rates und so weiter. Deshalb glaube ich, dass wir damit leben müssen, dass sowohl in großen als auch in kleinen Ländern sich immer eine Gruppe von Menschen findet, die Schwierigkeiten haben, sich in die Realität einzufinden. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Das wäre alles, was ich dazu sagen möchte.
Das heißt, russische Bürger schreiben Ihnen so etwas?
- Ja.
Vielleicht können Sie uns später diese Zuschriften zeigen?
- Ja, ja. Ich denke, wir haben sie in unserem Archiv aufbewahrt. Briefe, Dokumente mit Stempeln und so weiter.
Glauben Sie, dass es bei den Reichsbürgern eine „russische Spur“ gibt? Über so etwas hat man in Deutschland gesprochen.
- Das weiß ich nicht, ehrlich, ich weiß es nicht.
Vor Kurzem wurden Sie in das russische Außenministerium einbestellt – wegen einer anderen Sache, und zwar wegen der Situation russischer Medien in Deutschland. Im Außenministerium spricht man von „Druck“, „systematischen Einschränkungen“ und „Versuchen, aus diversen Scheingründen die journalistische Tätigkeit beschränken“. Von dem, was veröffentlicht wird, von dem, was ich aus persönlichen Kontakten weiß (die journalistische Community ist recht eng, und ich weiß ein bisschen über die Situation nicht nur der staatlichen Medien, die unter Sanktionen stehen): Manche russischen Journalisten, die in Berlin akkreditiert sind, erleben, dass ihre Akkreditierung beim Auswärtigen Amt verlängert wird, aber gleichzeitig…
- Russische Journalisten in Berlin?
Ja.
- Aber sie haben nichts mit dem Auswärtigen Amt zu schaffen, weil es bei uns kein Akkreditierungssystem gibt. Wenn Sie als Journalist in Deutschland arbeiten wollen, können Sie sich Visitenkarten drucken lassen, das Wort „Journalist“ darauf schreiben und schon sind Sie ein Journalist. Niemand akkreditiert Sie.
Das heißt, sie brauchen keine Akkreditierung beim Auswärtigen Amt?
- Nein.
Aber sie sagen ja gerade, dass sie eine Akkreditierung vom Auswärtigen Amt haben. Aber die Berliner Behörden verlängern ihre Aufenthaltstitel nicht.
- Was wir als Botschaft tun: Wenn russische Journalisten in Deutschland arbeiten wollen, brauchen sie ein Visum. Damit kommen sie zu uns und bekommen ein Visum. Dann gehen sie nach Deutschland. Und dort hat das Auswärtige Amt nichts damit zu tun, was ihre Kontakte betrifft. Sie werden wie alle anderen in Deutschland lebenden Ausländer behandelt und sie müssen sich an die Landesbehörden wenden, in diesem Fall ist es das Bundesland Berlin. Es ist so wie ein Verwaltungsgebiet hier in Russland. Ich meine, es sind Behörden. Dort bekommen sie einen Aufkleber in ihre Pässe, der ihnen die Möglichkeit gibt, ein Jahr lang dort zu leben und als Journalisten zu arbeiten. Oder sie müssen belegen, dass sie ein Einkommen haben und sich als Ausländer in Deutschland aufhalten können, da sie nicht unser Sozialsystem belasten. So funktioniert es. Es existiert keine Akkreditierungspflicht. Während deutsche Journalisten, die in Moskau leben und arbeiten, gezwungen sind, alle drei Monate eine sehr komplizierte bürokratische Prozedur beim russischen Außenministerium zu durchlaufen, ihre Akkreditierung zu verlängern, und wenn sie es nicht tun, verlieren sie das Recht, hier zu arbeiten. Und jetzt hatten wir die Situation, dass zwei oder drei russische Journalisten Probleme mit der Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis hatten, und ich kann verstehen, dass es das russische Außenministerium nicht erfreut, deshalb hat Maria Sacharowa mich eingeladen, um darüber zu sprechen, und das haben wir auch getan.
Aber ich habe Mitteilungen des Auswärtigen Amtes gesehen. Sie sagen: Wir behindern nicht die Arbeit der Journalisten, alle Fragen bitte an die Berliner Behörden.
- Genau, das sage ich ja auch. Hier haben deutsche Journalisten, wenn sie ihre Arbeit machen, immer wieder Schwierigkeiten mit – ich sage mal – bestimmten Behörden, und das ist ein Dauerproblem. Und genau das habe ich Frau Sacharowa bei unserem Gespräch erzählt. Ich halte es für wichtig, dass wir Journalisten aus dem jeweils anderen Land bei uns haben. Das ist wunderbar. Wichtig zu verstehen ist auch, dass aus Sicht der russischen Behörden nur eine bestimmte Anzahl an russischen Journalisten sich in Berlin befindet. Wir wissen, dass es viel mehr sind, weil manche russischen Medien nicht mehr in Russland arbeiten dürfen. TV Rain, Echo Moskwy, Meduza, Sota. Sie alle können hier nicht arbeiten, deshalb arbeiten sie von Berlin aus. Es sind russische Journalisten und sie haben überhaupt keine Probleme.
Womit hängt dann die Nichtverlängerung der Aufenthaltsgenehmigung nun zusammen?
- Das sind Fragen an das Land Berlin.
Aber formal ist es doch ein Hindernis für ihre Tätigkeit. Wenn sie kein Recht mehr haben, sich in Deutschland aufzuhalten, dann können sie dort auch nicht arbeiten.
- Das stimmt, aber es ist nicht die Entscheidung der Bundesregierung. Das ist eine Entscheidung des Landes Berlin. Und ich denke, dass die Diskussion, die wir in dieser Frage hatten, eine Fortsetzung haben wird. Mal sehen, ob wir eine produktive Lösung finden.
In Berlin ist die SPD an der Macht, eine Regierungspartei auf Bundesebene. Hat es Einfluss auf die Entscheidung?
- Das hängt in keiner Wiese mit Parteipolitik zusammen. Es ist eine Frage der Rechtsanwendung. Die Regeln sind öffentlich und bekannt, man kann sich an ein Gericht wenden, um die Entscheidung anzufechten, das kann jeder tun. Während wir in der Vergangenheit Fälle hatten, dass deutsche Journalisten gebeten wurden, Russland zu verlassen, und sie konnten sich nicht an ein Gericht wenden. Es gibt kein Gericht, keinen Rechtsweg. Es gibt eine Entscheidung. Das ist der Unterschied. Bei uns sind die Gerichte für alle offen, gegen die administrative Maßnahmen beschlossen wurden, unabhängig davon, ob es Ausländer oder deutsche Staatsangehörige sind. Und man muss sagen, dass die Gerichte oft nicht zugunsten der Behörden, sondern zugunsten von Ausländern entscheiden. Wir hatten gerade den Fall von drei Afghanen, da hatte die Regierung beschlossen, dass sie nicht nach Deutschland kommen dürfen. Aber das Gericht entschied: Nein, das ist eine andere Situation, sie dürfen nach Deutschland kommen.
Übrigens schrieb Maria Sacharowa während des Treffens im Außenministerium auf ihrem Telegram-Kanal: „Wie es sich herausstellt, kann der deutsche Botschafter kein Russisch, er geht einen Dolmetscher holen“. Wie sieht es mit Ihrem Russisch aus?
- Wissen Sie, mein Russisch ist nicht so gut, dass ich Fachgespräche mit Maria oder jemandem von meinen russischen Kollegen im Außenministerium führen kann. Uns wurde im Vorfeld mitgeteilt – und das war der Grund für die Verzögerung –, dass das Gespräch auf Englisch geführt wird, und mein Englisch ist ausreichend für ein Fachgespräch. Aber dann beschloss Maria Sacharowa, dass sie das Gespräch auf Russisch führen möchte, was ihr gutes Recht ist. Wir sind hier in Russland, und wenn sie möchte, dass das Gespräch auf Russisch stattfindet, dann ist das ganz normal, bloß hatten ihre Kollegen uns mitgeteilt, dass es auf Englisch stattfinden wird. Und deshalb brauchten wir eine Stunde, um unseren Dolmetscher zu holen.
Aber Sie nehmen Russischunterricht?
- Ja, das tue ich.
Sie sind bald zwei Jahre als Botschafter hier. Sie wurden offenbar als Krisenbotschafter nach Moskau entsandt. Verstehen Sie das Land mittlerweile besser?
- Ja, natürlich! Wenn man seit zwei Jahren in Moskau lebt, viel durch das Land reist (auch wenn nicht so viel, wie ich gerne tun würde), hier mit Menschen spricht, hilft es, Russland besser zu verstehen. Und ich halte es für eine meiner wichtigsten Aufgaben hier, zu verstehen, was im Land passiert. Wie funktioniert die Gesellschaft. Was motiviert die Menschen wirklich, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Warum trifft die Regierung die Entscheidungen, die sie trifft. Und dann darüber nach Berlin zu berichten, damit dort ein zutreffendes Bild davon entsteht, wie Russland ist und was die Menschen hier denken.
Herr Botschafter, vielen Dank für dieses Gespräch.
- Vielen Dank.